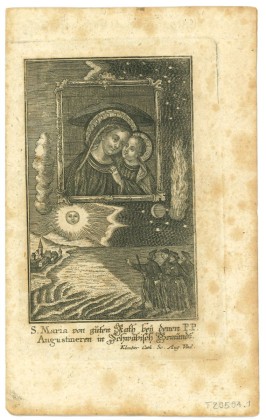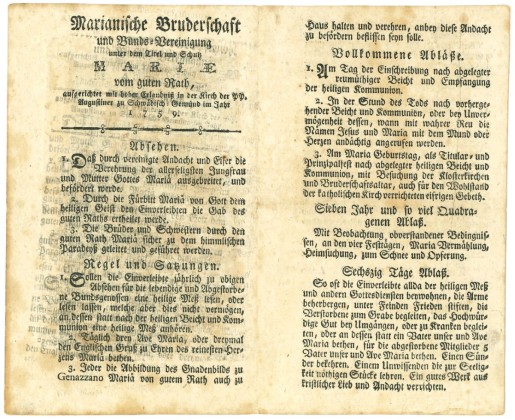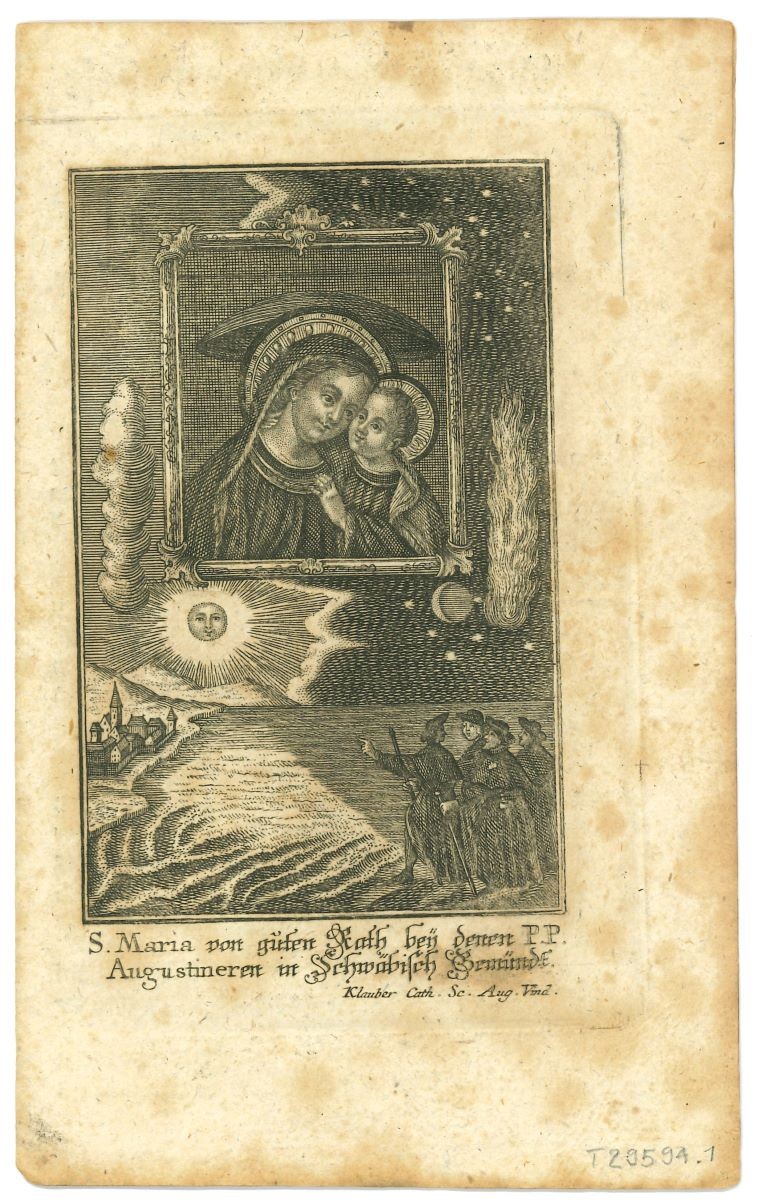Über die Sammlung
Das Historische Museum Thurgau ist gemäss Leistungsauftrag des Kantons Thurgau für die volkskundliche, die kulturhistorische und die ethnografische Sammlung verantwortlich. Rund 50 000 Objekte zählen die drei Sammlungen – darunter u.a. Klosterschätze, Gemälde, Grafiken, volkskundliche Geräte, Ethnografika, Militaria, Münzen, Industriegut und Alltagsgegenstände vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Viele Objekte blieben bislang verborgen und lagern seit über hundert Jahren in den Depots.
Mit der Sammlung Online öffnen wir die Tore zu unseren Depots und bieten Ihnen einen digitalen Zugang zu den Beständen. Gegliedert nach Schwerpunkten (Kategorien) erhalten Sie Einblick in einen repräsentativen Querschnitt unserer Sammlungen.
Unser «Online-Schaufenster» zum Stöbern und gezielten Recherchieren bietet Informationen zu den Objekten samt Abbildungen und soll den gegenseitigen Austausch zu Sammlungsinhalten fördern. Laufend kommen weitere Objekte hinzu.